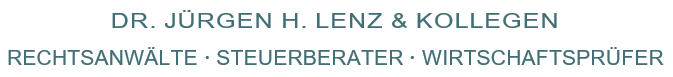Wird eine Immobilie vererbt oder im Wege der Schenkung übertragen, muss die Immobilie für die Erbschaft- oder Schenkungsteuer bewertet werden.
Dies ist daher relevant, da es sich in der Regel um relativ wertvolle Vermögensgegenstände handelt und die Bewertung von vielen Faktoren abhängig ist. Wird eine Immobilie zwischen fremden Dritten veräußert, ist ein fremdüblicher Kaufpreis bekannt. Wird die Immobilie hingegen vererbt oder verschenkt, findet kein Verkauf statt. Eine Bewertung muss daher anhand anderer Bewertungsverfahren erfolgen.
Wie werden unbebaute Grundstücke bewertet?
Die Bewertung eines unbebauten Grundstücks erfolgt nach § 179 BewG (Bewertungsgesetz).
Dabei wird grundsätzlich die Fläche des Grundstücks mit dem von einem örtlichen Gutachterausschuss festgelegten Bodenrichtwert multipliziert.
Grundsätzlich können die Bodenrichtwerte elektronisch über das Internet abgefragt werden, wobei sich die Abfrageportale je nach Bundesland und Ort unterscheiden können. Die Abfrage ist meist kostenpflichtig, wobei sich die Gebühren im Rahmen von rund EUR 20 bis EUR 50 je Grundstücksfläche bewegen.
Für die Abfrage sind meist folgende Daten notwendig:
- Anschrift des Grundstücks
- Grundbuchblatt/Flur
- Flurstück
Manchmal reicht auch die Anschrift des Grundstücks aus, um die Auskunft zu erhalten.
Die Bewertung ist des Grundstücks ist dabei relativ fix, wobei grundstücksindividuelle Besonderheiten, die zu einer niedrigeren Bewertung führen, unbedingt gegenüber dem Finanzamt angegeben und nachgewiesen werden sollten.
Sofern in Ausnahmefällen vom Gutachterausschuss kein Bodenrichtwert für eine Grundstücksfläche bereitgestellt wird, ist der Bodenwert (= Wert des Grundstücks) anhand der Regelung nach § 179 S. 4 BewG aus dem Wert eines vergleichbaren Grundstücks abzuleiten.
Wie erwähnt, sollten Besonderheiten des individuellen Grundstücks bei der Bewertung des Grundstücks beachtet werden. Führen diese zu einer Abwertung des Grundstückswerts, sollten diese gegenüber dem Finanzamt belegt werden. Eine niedrigere Bewertung des Grundstücks ist dadurch grundsätzlich möglich.
Sofern mit dem Finanzamt keine Einigung über einen Grundstückswert erzielt werden kann, sollte über die Einschaltung eines Sachverständigen nachgedacht werden, der eine externe Grundstücksbewertung vornehmen kann. Zu beachten ist jedoch, dass dies Kosten verursacht.
Welche Bewertungsverfahren gibt es für bebaute Grundstücke?
Bebaute Grundstücke sind in der Regel aufwendiger in der Bewertung als unbebaute Grundstücke.
Die Bewertung des Grundstücksanteils erfolgt dabei nach den zuvor beschriebenen Grundsätzen für die Bewertung von unbebauten Grundstücken.
Die Bewertung der auf diesen Grundstücken befindlichen Immobilien bzw. Gebäuden erfolgt nach unterschiedlichen Verfahren:
- Vergleichswertverfahren
- Ertragswertverfahren
- Sachwertverfahren
Je nach Gebäudetyp und/oder Nutzung des Gebäudetyps kommt dabei nur ein bestimmtes Bewertungsverfahren in Betracht.
- Vergleichswertverfahren:
- Wohnungseigentum
- Teileigentum
- Einfamilienhäuser
- Zweifamilienhäuser
- Ertragswertverfahren
- Mietwohngrundstücke
- Geschäftsgrundstücke
- gemischt genutzte Grundstücke
- Sachwertverfahren:
- Grundstücke des Vergleichswertverfahrens, für die sich kein Wert hierüber ermitteln lässt
- Grundstücke des Ertragswertverfahrens, für die sich kein Wert hierüber ermitteln lässt
- sonstige bebaute Grundstücke
Bei Erbbaurechten, Erbbaugrundstücken, Gebäude auf fremden Grund und Boden sowie bei Grundstücken im Zustand der Bebauung kann nach § 196 BewG ein abweichendes Bewertungsverfahren anzuwenden sein.
Zudem ist der Nachweis eines niedrigeren tatsächlichen Marktwerts anhand eines Verkehrswertgutachten eines Sachverständigen möglich.
Was bedeutet das Vergleichswertverfahren?
Nach § 183 BewG werden beim Vergleichswertverfahren die Kaufpreise vergleichbarer Grundstücke herangezogen, um den Wert der zu bewertenden Immobilie zu ermitteln.
Vergleichbar bedeutet, dass die wertbeeinflussenden Merkmale eines bebauten Grundstücks im Wesentlichen übereinstimmen.
Bei den örtlich zuständigen Gutachterausschüssen kann angefragt werden, ob eine entsprechende vergleichbare Bewertung vorliegt. Liegt dieser vor, erhält man als Auskunft einen Vergleichskaufpreis.
In vielen Fällen wird es jedoch keinen Vergleichswert geben, da die Beschaffenheit der Grundstücke und Immobilien sich auch bei Nachbargrundstücken häufig unterscheidet.
Hilfsweise kann auch ein Vergleichs-Quadratmeter-Preis herangezogen werden.
Da es in der Praxis schwierig ist, einen tatsächlich verwendbaren Vergleichswert zu erhalten, wird das Vergleichswertverfahren selten angewandt. Kann es nicht angewandt werden, wird zum Sachwertverfahren übergegangen.
Das Vergleichswertverfahren kann zudem nur dann angewandt werden, wenn ausreichend viele Vergleichswerte vorliegen. Nur in Ausnahmefällen reicht es aus, wenn nur ein einziger Vergleichswert vorliegt.
Zudem kann der Kaufpreis eines Vergleichsgrundstücks nur dann herangezogen werden, wenn dieser Kaufpreis innerhalb eines Jahres vor dem Bewertungsstichtag zustande gekommen ist. Auch dies führt in der Regel dazu, dass das Vergleichswertverfahren relativ selten angewandt werden kann.
Was bedeutet das Ertragswertverfahren?
Wie der Name des Ertragswertverfahrens vermuten lässt, werden mit diesem Bewertungsverfahren bebaute Grundstücke bewertet, aus denen ein Ertrag erzielt werden kann, also zum Beispiel eine vermietete Eigentumswohnung.
Das Verfahren ist in § 184 BewG geregelt. Der Ertragswert ermittelt sich dabei folgendermaßen:
Rohertrag
– Bewirtschaftungskosten
——————————
= Reinertrag
– Verzinsung des Bodenwerts
——————————
= Gebäudereinertrag
x Vervielfältiger nach Anlage 21 zum BewG
——————————
= Gebäudeertrag
+ Wert des Grund und Bodens
——————————
= Ertragswert des bebauten Grundstücks
Der Rohertrag ist die Miete, die vertragsgemäß zu bezahlen ist. Es zählt die vereinbarte Miete. Die tatsächlich gezahlte Miete ist somit irrelevant. Es wird die Miete für den Zeitraum von zwölf Monaten vor dem Bewertungsstichtag herangezogen. Zusätzlich sind die folgenden Entgelte einzubeziehen (R B 186.1 Abs. 1 EStR):
- Mieteinnahmen für Stellplätze
- Mieteinnahmen für Nebengebäude, z. B. Garagen
- Vergütungen für außergewöhnliche Nebenleistungen des Vermieters, die nicht die Raumnutzung betreffen (z. B. Reklamenutzung, Aufstellen von Automaten)
- Vergütungen für Nebenleistungen, die zwar die Raumnutzung betreffen, jedoch nur einzelnen Mietern zugute kommen (z. B. Einnahmen für Internet, Klimaanlage, Schwimmbäder)
- Untermietzuschläge
- Baukostenzuschüsse
- Mietvorauszahlungen, die auf die Miete anzurechnen sind
- Zahlungen des Mieters an Dritte für den Eigentümer, soweit es sich nicht um Betriebskosten handelt
- Leistungen des Mieters, die nicht in Geld bestehen und soweit sie nicht als Betriebskosten zu berücksichtigen wären (z. B. die Übernahme der Grundstücksverwaltung)
- um Neben- und Betriebskosten bereinigte Leasingraten, soweit sie auf die Überlassung des Grundstücks entfallen.
Nicht einzubeziehen sind dabei:
- Umlagen zur Deckung der Betriebskosten
- Einnahmen für die Überlassung von Maschinen und Betriebsvorrichtungen
- Einnahmen für die Überlassung von Einrichtungsgegenständen (z. B. bei möblierter Vermietung)
- Dienstleistungen, die nicht die Grundstücksnutzung betreffen (z. B. Reinigungsdienstleistung)
- Zuzahlungen Dritter außerhalb des Mietverhältnisses
- Aufwendungszuschüsse im öffentlich geförderten Wohnungsbau
- Umsatzsteuer
Wird die Immobilie teilweise selbst genutzt, ist sie teilweise ungenutzt, wird sie unentgeltlich oder um mehr als 20% verbilligt vermietet, ist nach § 186 Abs. 2 BewG die übliche Miete zu verwenden. Dabei bleiben übliche Betriebskosten unbeachtet. Die übliche Miete ist die Miete, die üblicherweise für Räume gleicher oder ähnlicher Art, Lage und Ausstattung gezahlt wird. Die übliche Miete ist ggf. zu schätzen. Eine vereinbarte Miete ist nicht üblich, falls sie mehr als 20% unterhalb des unteren Werts des Mietspiegels bzw. mehr als 20% höher als der oberste Wert des Mietspiegels ist.
Die Bewirtschaftungskosten werden grundsätzlich durch den örtlichen Gutachterausschuss bestimmt. Liegen diese nicht vor, so sind pauschale Bewirtschaftungskosten nach Anlage 23 zum BewG zu verwenden.
Für die Ermittlung der Restnutzungsdauer eines Gebäudes ist Anlage 22 zum BewG heranzuziehen. Sind nach der Errichtung des Gebäudes Veränderungen daran vorgenommen worden, kann dies zur Verlängerung der Restnutzungsdauer führen, insbesondere wenn innerhalb der letzten 10 Jahre vor dem Bewertungsstichtag Sanierungen/Modernisierungen erfolgen. Eine Verkürzung der Restnutzungsdauer ist möglich, wenn eine Abbruchverpflichtung besteht. Baumängel oder Bauschäden verkürzen in dem typisierten Verfahren allerdings nicht die Restnutzungsdauer. Die Restnutzungsdauer eines Gebäudes beträgt mindestens 30% der Gesamtnutzungsdauer.
Bei der Bodenwertverzinsung ist der Liegenschaftszinssatz nach § 188 BewG zugrunde zu legen. Der Liegenschaftszinssatz ist der Zinssatz, mit dem der Verkehrswert von Grundstücken im Durchschnitt marktüblich verzinst sind. Der Liegenschaftszinssatz wird vom örtlichen Gutachterausschuss bekannt gegeben. Falls nicht, sind nach § 188 Abs. 2 S. 2 BewG bestimmte Prozentsätze anzuwenden.
Der individuelle Vervielfältiger ist in Anlage 21 zum BewG angegeben und abhängig vom Liegenschaftszinssatz und der Restnutzungsdauer des Grundsücks.
Als absoluter Mindestwert für dieses Bewertungsverfahren ist der Bodenwert zu berücksichtigen.
Was bedeutet das Sachwertverfahren?
Das Sachwertverfahren kann als Auffangverfahren bezeichnet werden, da es immer dann zur Anwendung kommt, wenn das Ertragswertverfahren oder Vergleichswertverfahren nicht anwendbar ist, sie es aufgrund gesetzlicher Regelung oder dadurch, dass keine geeigneten Daten für die anderen Bewertungsverfahren vorliegen.
Es erfolgt eine gesonderte Ermittlung des Bodenwerts und eine gesonderte Ermittlung des Gebäudewerts.
Der Sachwert ermittelt sich folgendermaßen:
Regelherstellungskosten
x Baupreisindex
x Bruttogrundfläche des Gebäudes
——————————
= Gebäuderegelherstellungskosten
– Alterswertminderung, höchstens 70%
——————————
= Gebäudesachwert
+ Wert des Grund und Bodens
——————————
= Sachwert, vorläufig
x Wertzahl
——————————
= Sachwert des bebauten Grundstücks
Die Regelherstellungskosten ermitteln sich aus Anlagen 24 Teil II zum BewG. Sie werden in Abhängigkeit von der Gebäudeart und dem Gebäudestandard angegeben.
Es gibt 18 verschiedene Gebäudearten in Anlage 24 Teil II zum BewG.
Der Gebäudestandard erfordert die Standardbestimmung von neun verschiedenen Gebäudeteilen:
- Außenwände
- Dach
- Fenster und Außentüren
- Innenwände und Innentüren
- Deckenkonstruktion und Treppen
- Fußböden
- Sanitäranlagen
- Heizung
- sonstige technische Anlagen
Auf Grundlage der Standardbestimmung wird ein gewichteter Durchschnitt der Regelherstellungskosten ermittelt.
Die Regelherstellungskosten sind mit einem Baupreisindex auf den Bewertungsstichtag zu ermitteln. Damit werden die pauschalierten Kosten an das jeweilige Jahr der Bewertung angepasst. Das Bundesministerium der Finanzen veröffentlicht jährlich in einem BMF-Schreiben die anzuwendenden Baupreisindizes.
Die Bruttogrundfläche ist nach Anlage 24 zum BewG die Summe der auf den jeweiligen Gebäudetyp bezogenen, marktüblich nutzbaren Grundflächen aller Grundrissebenen. Die Bruttogrundfläche unterscheidet sich damit sich von der Wohnfläche. Die Ermittlung der Bruttogrundfläche ist regelmäßig schwierig, da diese Fläche dem Eigentümer oft nicht bekannt ist. Für Eigentumswohnungen und Mehrfamilienhäuser kann nach Anlage 24 zum BewG vereinfacht die Wohnfläche mit 1,55 multipliziert werden, um auf die Bruttogrundfläche zu kommen. Die Ermittlung der Bruttogrundfläche für andere Gebäudearten ist jedoch nur durch Einsicht in die Bauunterlagen oder durch Einschaltung eines Architekten möglich.
Die Alterswertminderung bestimmt sich nach dem Verhältnis des Alters des Gebäudes zum Bewertungsstichtag zur typisierten wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer nach Anlage 22 zum BewG. Der Mindestwert beträgt 30% der Gesamtnutzungsdauer.
Der Wert des Grund und Bodens ermittelt sich aus Multiplikation des Bodenrichtwerts mit der Grundstücksfläche. Anders als beim Ertragswertverfahren stellt der Bodenwert jedoch nicht den Mindestwert des Ertragswertverfahrens dar.
Die Wertzahl wird vom örtlichen Gutachterausschuss vorgegeben und soll eine Anpassung an die regionalen Bedingungen darstellen. Wird vom Gutachterausschuss keine Wertzahl bereitgestellt, kann diese Wertzahl nach Anlage 25 zum BewG ermittelt werden.
Nachweis eines niedrigeren tatsächlichen Marktwerts
Das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren und das Sachwertverfahren sind Bewertungsverfahren, die anhand typisierender Merkmale oder Werten eine Bewertung ermöglichen.
Diese typisierenden Bewertungsverfahren können jedoch zu einem falschen Ergebnis führen. Relevant ist dies regelmäßig dann, wenn der mit einem Bewertungsverfahren ermittelte Wert deutlich über dem tatsächlichen Marktwert liegt.
Nach § 198 BewG kann in diesen Fällen mit einem Verkehrswertgutachten eines Sachverständigen ein niedrigerer tatsächlicher Marktwert nachgewiesen werden.
Das Verkehrswertgutachten muss dabei entweder durch den örtlichen Gutachterausschuss oder durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für die Bewertung von Grundstücken erstellt werden. Es werden auch Gutachten anerkannt, die von einer staatlichen, staatlich anerkannten oder nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Stelle als Sachverständige oder Gutachter für die Bewertung von Grundstücken bestellt wurden.
Das Finanzamt muss das von einem Steuerpflichtigen vorgelegte Bewertungsgutachten allerdings nicht anerkennen. Und das Finanzamt muss bei einer Nicht-Anerkennung des Verkehrswertgutachtens auch kein Gegengutachten erstellen lassen oder vorlegen.
Die Anerkennung eines Verkehrswertgutachtens kann insbesondere dann scheitern, wenn methodische Mängel oder unzutreffende Wertansätze enthalten sind. Bei der Auswahl eines Gutachters sollte daher insbesondere darauf geachtet werden, dass dieser mit seinen in der Vergangenheit erstellten Verkehrswertgutachten immer bei den prüfenden Finanzämtern erfolgreich war.
Ist ein tatsächlicher Kaufpreis relevant?
Ein niedrigerer tatsächlicher Marktpreis kann durch einen Kaufpreis nachgewiesen werden, der innerhalb von zwölf Monaten vor oder nach dem steuerlichen Bewertungsstichtag für das zu bewertende Grundstück zustande gekommen ist.
Nach Abstimmung mit dem Finanzamt kann allerdings auch ein außerhalb dieses Zeitraums erfolgter Kauf/Verkauf für die Verkehrswertermittlung zugrunde gelegt werden, wenn sich die Verhältnisse im Vergleich zum Bewertungszeitpunkt nicht wesentlich geändert haben.
Hilreich kann hierbei auch ein Verkehrswertgutachten sein, aus dem sich ergibt, dass keine wesentlichen Änderungen im Vergleich zum früheren/späteren Kauf- bzw. Verkaufszeitpunkt erfolgt sind.
Aber auch wenn ein niedrigerer Marktwert mit Hilfe eines Verkehrswertgutachtens nachgewiesen wurde und innerhalb eines Jahres vor oder nach dem Bewertungsstichtag ein tatsächlicher Verkauf/Kauf zu einem höheren Wert stattfindet, kann dieser höhere Kaufpreis durch das Finanzamt der Bewertung zugrunde gelegt werden.
Sollte für die pauschalierte Immobilienbewertung ein Steuerberater beauftragt werden?
Während die Erstellung eines Verkehrswertgutachtens für eine Immobilie nur ein entsprechend fachkundiger Gutachter vornehmen kann, ist die pauschalierte Immobilienbewertung mit den im Bewertungsgesetz angegebenen Vergleichswert-, Ertragswert- und Sachwertverfahren sowohl für den Steuerpflichtigen selbst als auch für einen Steuerberater möglich.
Bei Einschaltung eines Steuerberaters besteht zudem die Möglichkeit, die Auswirkung der Bewertung auf den gesamten Schenkungs- oder Erbschaftsfall zu beachten und mit dem Steuerpflichtigen zu besprechen. Dies vermeidet unverhoffte Überraschungen.
Auch bei Einschaltung eines Steuerberaters zur Erstellung einer Erbschaftsteuererklärung oder Schenkungsteuererklärung kann zusätzlich ein Verkehrswertgutachten durch einen Gutachter erstellt werden. Ein Steuerberater bespricht mit dem Steuerpflichtigen die Möglichkeiten und auch, ob sich die Einholung eines Verkehrswertgutachtens lohnen kann oder nicht.
Da es bei einer Immobilienbewertung in der Regel um relativ hohe Werte geht und in der Folge auch um hohe Steuerbeträge, empfehlen wir immer, den Sachverhalt mit einem Steuerberater zu besprechen und die genaue Vorgehensweise abzustimmen. Nicht selten sind steuerliche Unterschiede von mehreren zehntausend oder gar hunderttausend Euro die Folge. Bei diesen Beträgen wird schnell ersichtlich, dass es sich finanziell lohnen kann, nicht ohne Steuerberater eine Immobilienbewertung für ein bebautes oder unbebautes Grundstück vorzunehmen.
Sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne zu Vermögensübertragungen, zur Schenkungsteuer und zur Erbschaftsteuer.